
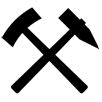
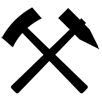
Helmut Heinl Autorenseite
"Leben in der Bergmannssiedlung"
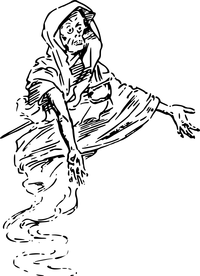 Aberglauben bei den Sulzbacher Bergleuten?
Aberglauben bei den Sulzbacher Bergleuten?In der Vorstellung der Bergleute aus alter Zeit war die Erde über und unter Tage von Lebendigem durchwoben. Erinnern wir uns an den Glauben der Alten, das tote Gestein zeuge und gebäre Edelsteine und edle Metalle. In der Bergbau-Fachliteratur des 18. Jhdt. ist noch von Bergmännlein die Rede. Das bedeutet, dass der Bergmann früher an diese Dinge wirklich glaubte. Auch die bekanntesten Sagengestalten, die Zwerge, sollen auf Bergleute zurückzuführen sein. Natürlich fällt einem da zuerst das Märchen vom Schneewittchen ein.
Wer einmal in einem alten Bergwerk war, abseits vom Getriebe, kann verstehen, dass die Menschen früherer Jahrhunderte für Geheimnisumwobenes aufnahmebereit waren. Es ist dort absolut finster, totenstill, die Luft ist dumpf – nur manchmal hört man den Ausbau knacken oder Wasser tropfen. Das Licht der Karbidlampe wirft bewegliche Schatten auf die Wände. Alles nicht sehr beruhigend!
So war es um die Jahrhundertwende auch in den Tagen zwischen Weihnachten und Heilig Drei König. Da waren oft nicht mehr als 10 Mann im ganzen Bergwerksgebäude. Einer oder zwei hatten Dienst an der Wasserhaltungsmaschine, die damals noch mit einer Dampfmaschine betrieben wurde. Der Rest war für Reparaturarbeiten, in kleinen Gruppen, in der ganzen Grube verteilt. Der Steiger war alleine unterwegs, damals noch mit der Öllampe. Nichts für ängstliche Gemüter!
Wenn es auch bei den Bergleuten in unserer Gegend keinen ausgeprägten Aberglauben und schon gar keinen Geisterglauben mehr gab, waren doch bei den Alten noch bis nach dem Zweiten Weltkrieg Überbleibsel vorhanden. Manches erinnerte nicht nur an frühere Gepflogenheiten, sondern wurde sogar noch angewendet. Das galt zum Beispiel für die Frauen der Bergmannsfamilien. Sie durften zwischen Weihnachten und „Heilig Drei König“ nicht waschen, weil diese Wäsche sonst Totenwäsche geworden wäre. So-gar meine Mutter hielt sich an diese Regel, obwohl sie sonst recht christlich war. Um nichts in der Welt war sie dazu zu bewegen, während dieser Tage zu waschen. Sie teilte sich das so ein, dass die Wäsche reichte. Die verhängnisvolle Zeit wurde bei uns „d´ Unternacht“ (die Unternächte) geheißen, vermutlich, weil die Gestalten aus der Unterwelt in diesen Nächten ihr Unwesen trieben. Der Aberglaube ist heute noch präsent.
Auch die Nachbarn reihum, egal, ob evangelisch oder katholisch wuschen nicht. Was nicht wundert, denn gerade bei den Bergmannsfamilien war die Gefahr eines plötzlichen Todes für den Vater real. Es waren schließlich öfter die Sprüche „hinter der Hacke ists duster“ oder „hinterm Ort lauert er“ zu hören.
Selbst in Rosenberg gab es 1913 noch Anklänge an Aberglauben. In „Allgemeine Pfarrbeschreibung“ der Ev.- luth. Pfarrei Rosenberg aus dem Jahr 1913 ist auf S. 73 u. a. Folgendes zu lesen: „In dem Jahresbericht von 1831 werden auf dem Annaberg Opfergaben in der dortigen katholischen Kirche dargebracht, eine Sitte, die bei Krankheiten von Mensch und Vieh noch 1879/82 nach dem Jahresbericht in Übung war. Auch aus dem Brauchen wurde kein Hehl gemacht, ein Unfug, der jetzt fast ganz verschwunden.“
Auf S. 102 heißt es: „Auf dem Wagen, auf dem die Leiche gefahren wurde, dürfen die Strohbüschel, auf denen der Sarg gestanden hat, nicht mehr mit nach Hause gebracht werden, weil sonst ein neuer Todesfall eintritt. Es muss so rasch gefahren werden, dass die Büschel auf dem Weg verloren gehen. Das sonst übliche Auftreiben des Viehs und das Umrühren des Saatgutes in der Stunde, in der ein Toter aus dem Haus getragen wird, findet hier nicht statt.“
Es gab aber auch „Eigenheiten“ in den „Eisensteingruben“. Das Wissen darüber stammt vom früheren Auerbacher Sicherheitsingenieur Martin Nägele, einem Mann, der außerordentlich am Bergbau und der Dokumentation seiner Geschichte interessiert ist. Er erzählte mir, als er 1951 am Etzmannsberg als Schlepper anfuhr, war es bei den alten Bergleuten verpönt, in der Grube zu singen oder zu pfeifen. Deshalb schlossen sich die Jungen, zu denen er damals gehörte, in Gruppen zusammen. Sie fuhren als letzte mit dem Förderkorb ein und gingen (bis zu 20 Minuten), auch mit größerem Abstand zu den Alten, zu den einzelnen Abbauorten, damit sie ungestört singen und pfeifen konnten.
Die Haltung der Alten hatte nichts mit fehlender Musikalität zu tun, sondern ist vermutlich – wie bei den Seeleuten auch – auf den Aberglauben zurückzuführen, pfeifen und singen würden Unglück heraufbeschwören.
Außerdem waren Frauen in der Grube absolut unerwünscht. Auch wenn es um die Wende zum 20. Jahrhundert kaum denkbar war, dass eine Frau in eine „Eisensteinzeche“, wie sie damals noch genannt wurde, einfuhr. Wie hätte sie mit ihren langen Röcken die Fahrten (eiserne Leitern) hinabsteigen sollen, die bis zu 90 Meter in die Tiefe führten. Und unten war es viel zu nass und schmutzig, um mit Röcken und normalen Schuhen herumzulaufen. Wenn Frauen in Bergwerken nicht erwünscht waren, so war das nicht nur auf Deutschland beschränkt. Der Bergbauhistoriker Heilfurth erwähnt in „Bergbau“ (1981), auf S. 209, die in amerikanischen Gruben bestehende Vorstellung, nach der weibliche Personen unter Tage „als Unglücksboten angesehen wurden“.
Schauermärchen allerdings, aus unserem Bergbau, sind mir nicht bekannt geworden - mit Ausnahme einer Geschichte, aus der man nicht recht schlau wird:
Das Gebiet zwischen der früheren Grube Etzmannsberg und dem Schacht Fromm war schon immer als ein „nasses Loch“ bekannt. Obwohl Mutungsbohrungen, seit 1889 dort ergiebige Erzvorkommen erwarten ließen, war es von Etzmannsberg oder der Grube Fromm aus nicht gelungen dorthin vorzustoßen. 1891 stand das Wasser im Schacht bis auf 67 m Teufe, am 24.9. wurde er geschlossen und erst Ende November 1891 wieder abgeteuft. Das Gleiche galt für eine spätere Verbindung zwischen der Grube Fromm und der Grube Etzmannsberg. Es gab heftige Wasser- und Schlammeinbrüche, die einen Abbruch der Aufschließungsarbeiten erzwangen. In alten Kopierbüchern der Sulzbacher Gruben 1908 -1911 sind immer wieder größeren Mengen Fichtenstreu erwähnt. Die benutzte man damals, um bei drohenden Schwimmsandeinbrüchen die Auswirkungen zu verringern. Die Streu sollte die festen Bestandteile aus dem Wasser- Schlammgemisch zurückhalten, damit der Pumpensumpf am Schacht frei blieb. Der „Respekt“ der Arbeiter vor dieser Gegend ist also nachvollziehbar.
In diesem überaus nassen Gebiet sollen zwei junge Bergleute verschüttet worden sein, die nie geborgen werden konnten. Sie sollen sogar noch den Wochenlohn bei sich ge-habt haben. So erzählte es mir mein Vater und so ähnlich ist es auch in der Zeitschrift „Die Oberpfalz“ von 1910 zu lesen. Jedenfalls hielt sich bis in unsere Zeit hartnäckig das Gerücht „dass dort noch welche liegen“.
Nach 1900, beim Vortrieb in ein neues Erzlager, wurde schon vorher „gemunkelt“, man werde das Erz nicht erreichen, weil „die, die dort liegen, niemand an sich heranlassen“. Man werde im Wasser „ersaufen“. Das bedeutete, starker Wasserzulauf wird den weite-ren Vortrieb verhindern.
Und tatsächlich – je näher man dem vermuteten Gebiet kam, desto mehr Wasser wurde gelöst. Die Wasserseige wurde vertieft und die Anzeichen deuteten darauf hin, dass ein Wasser- oder Schwimmsandeinbruch drohte. Der kam tatsächlich. Mit großer Wucht und in kürzester Zeit war „die Strecke zu“ (überschwemmt). Die Bergleute konnten sich nur mit Mühe in Sicherheit bringen. Stiefel, Gezähe und Lampen verschwanden im mah-lenden und saugenden Schlamm. Der Einbruch kam zum Stillstand. Aber bei den weite-ren Vortriebsarbeiten gab es so viele Schwierigkeiten, dass der Obersteiger die Einstel-lung anordnete. Die Skeptiker hatten wieder einmal recht behalten.
1939, an Fronleichnam, gab es einen großen Wassereinbruch auf der Grube Fromm, bei dem die ganze Grube absoff und zur Allerweltskirchweih (dritter Sonntag im Oktober) brach in Folge dessen unterhalb des Großenfalzer Feuerwehrhauses eine Pinge ein, die über viele Jahre sichtbar blieb. Das erinnerte natürlich die Bergleute wieder an die Geschichte mit den Verunglückten.
Der Auerbacher Sicherheitsingenieur Martin Nägele war nach 1945 als junger Berg-mann selbst beim Vortrieb einer Versuchsstrecke in dieser Gegend eingesetzt. Er be-richtete, dass auch hier die Arbeiten wegen zu viel Wasser- und Schlammeinbrüchen eingestellt werden mussten. Das Gebiet, in dem große Mengen Erz lagerten, blieb also gefährlich.
Bei den Vortriebsarbeiten, die in den sechziger Jahren vom Schacht Großenfalz in Rich-tung St. Anna-Schacht und umgekehrt erfolgten, sahen sich dann die Verfechter dieses Gerüchts erneut bestätigt. Es gab 1964, unter dem alten Ort Großenfalz, einen ganz großen und gefährlichen Schwimmsandeinbruch, in dessen Folge sich an der Oberflä-che ein riesiger Trichter bildete und beinahe ein Haus verschlungen hätte. Betroffen waren der Garten und das Haus des Bergmanns Georg Rubenbauer. Er musste wegen der akuten Einsturzgefahr 6 Wochen lang mit seiner Frau in einer Baracke schlafen. Dieses Ereignis war der endgültige Anstoß, für die Aussiedlung der Höfe von Großenfalz. Das Gebiet um die Schächte Fromm, Großenfalz und Etzmannsberg zeigte sich also immer wieder als besonders schwierig.
Auch heute, 2021, ist alten Bergleuten das Gerücht, dass im Gebiet um Fromm noch zwei Verschüttete liegen präsent. Trotzdem ist es falsch. Der langjährige Obersteiger Ludwig Ritter war ein sehr nüchterner und genauer Bergmann, der zu allen Unterlagen in der Maxhütte und im Bergamt Zugang hatte. Er ging der Geschichte von Verschütte-ten schon aus eigenem Interesse intensiv nach. Dennoch konnte er, wie er mir versi-cherte, keinerlei Beweise finden. Weder in den Unterlagen der Grubenverwaltung noch beim Bergamt war in dieser Gegend ein Unfall vermerkt. Dabei gingen die Akten weit mehr als ein Jahrhundert zurück und der Ort wäre, schon aus Respekt vor den Toten, in jedem Fall eingetragen gewesen. Das Gerücht hat sich bei vielen Bergleuten trotzdem bis lange nach dem Ende des Bergbaus gehalten.
Außer dieser Geschichte, bei der zwischen Dichtung und Wahrheit nicht genau unter-schieden werden kann, ist uns – trotz der Jahrtausende alten Bergbautradition- kein richtiger Aberglaube überliefert. Vielleicht ist unser Menschenschlag dazu zu nüchtern und vielleicht auch zu erdverbunden.
Überliefert hingegen und heute noch sichtbar ist eine tiefe Frömmigkeit, die alljährlich in der festlich gestalteten Barbarafeier zum Ausdruck kommt. Sie wird, nach meiner Kenntnis, von jeher von beiden Konfessionen gemeinsam gestaltet. Der Gottesdienst findet im Wechsel in beiden Kirchen statt. Es ist das „Hochfest“ der Bergleute.
© Helmut Heinl 2021

