
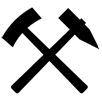
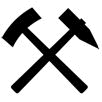
Helmut Heinl Autorenseite
"Leben in der Bergmannssiedlung"
Können diese Geschichten wahr sein?
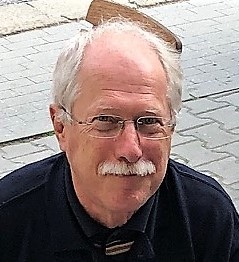 Helmut Heinl
Helmut Heinl"Leben in der Bergmannssiedlung"
Über Jahrtausende war der Bergbau selbstverständlicher Bestandteil dieser Stadt. Seit 1938 prägte er auch das Leben in der Feuerhofsiedlung. Was niemand aufschrieb, war der Arbeitsalltag der Bergleute, die oft ihr ganzes Leben in der abgeschlossenen Welt der Bergwerke gearbeitet haben.
Um diese Traditionen für nachfolgende Generationen zu bewahren, erzählt Helmut Heinl, in kurzen, amüsanten bis lehrreichen Geschichten, wie das Leben unter Tage in den letzten 150 Jahren war. Sein Anliegen ist es, die Werte und Traditionen der Erzgräber nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Die Geschichten stammen von Gesprächen mit Zeitzeugen und eigenen Recherchen, die er seit 1983 dokumentiert."
Die Geschichte zu den Geschichten
Seit die „Geschichten aus dem Bergbau“ veröffentlicht sind, werde ich oft gefragt, ob denn das alles stimme und woher ich die Geschichten habe. Dazu kann ich nur sagen, alles, was ich aufgeschrieben habe, wurde mir von Bergleuten aus der „Grube Sulzbach“ erzählt. (So meldete sich der Pförtner am Telefon.) Ich sammle diese Geschichten seit 1983 und hatte noch das Glück, Gespräche mit den „ganz Alten" auf Tonband aufzuzeichnen zu können. Die hatten schon lange vor dem Zweiten Weltkrieg in den Gruben Etzmannsberg, Fromm und Klenze gearbeitet. In den Anfangsjahren ihres Arbeitslebens haben sie das Erz noch traditionell mit Schlägel und Eisen hereingewonnen. In einer Zeit in der es unter Tage nur Handarbeit gab, war das Leben dort viel geruhsamer, wenn auch nicht weniger anstrengend. Die Männer haben die Einführung der Pressluftwerkzeuge und die Ausrüstung der Gruben mit elektrischem Strom erlebt und wie sich die Arbeitswelt durch die Technisierung verändert hat.
Als das Erz noch mit Schlägel und Eisen abgebaut wurde und etwas wert war, gab es weniger Hektik vor Ort. Es war mehr Zeit, für Gespräche und natürlich gelegentliche Streiche. Dabei möchte ich den Eindruck vermeiden, dass unsere Bergleute nur Unsinn im Kopf hatten. Aber die damalige Welt unter Tage war vom normalen Alltagsleben noch weiter entfernt, als in späteren Jahrzehnten. Der Abbau mit Bohrwagen, Kipplader und Transportwagen unter Tage hat dem Bergmannsleben seinen Ethos geraubt. Der hohe Arbeitsdruck, der unvorstellbare Lärm beim Maschineneinsatz und der Versuch der Grubenleitungen, mit den Produktionskosten der Importerze Schritt zu halten, war die Ursache.
Wer vor dem Ersten Weltkrieg in die Sulzbacher Gruben einfuhr, kam in eine abgeschlossene Welt: kein Strom, keine Technik. Man arbeitete in kleinen Gruppen, in einer verschworenen Gemeinschaft. Mit dem Besteigen des Förderkorbs, oder vor seiner Einführung, mit dem Hinabsteigen auf den Fahrten (Leitern) bis in 90 m Tiefe, blieb der Alltag zurück. Die Bergleute mussten sich nicht um wirtschaftliche Dinge, Produktionskosten oder Abbaumethoden Gedanken machen. Ihr Ziel war es, mit möglichst wenig Aufwand, das ausgehandelte Gedinge zu erreichen. Das reichte, um den Lebensunterhalt zu sichern. War die Schicht beendet, machte sich keiner mehr Gedanken über die Arbeit. Sie war abgeschlossen und blieb bis zum nächsten Tag im Schacht. Mit dem Umkleiden in der Kaue wurden nicht nur die schmutzige Arbeitskleidung aus- und die saubere Alltagskleidung angezogen. Die Arbeitswelt blieb hinter dem Grubenportal zurück.
Zu den Streichen:
Die Unwissenheit der Neuanfänger im Untertagebereich, mit derben Späßen auszunutzen, war gängige Praxis. Mit ihr konnte in Erfahrung gebracht werden, wie der Neue einzuordnen war. Hatte er diese "Bergtaufe“ bestanden und sich als „wehrhafter Typ“ erwiesen, war klar, dass er ein akzeptierter Bergmann werden würde. Denn ein solcher musste, wenn er später Hauer oder gar Fahrsteiger werden wollte, nicht nur hart arbeiten können. Er musste auch in Gefahrensituationen blitzschnell reagieren, zur eigenen Sicherheit und zum Schutz der Kameraden vor Ort. Zeigte sich der Bergneuling als nicht sehr gewieft, ordnete man ihn in der „Hackordnung“ weiter hinten ein.
Streiche galten auch den Störern, den unangepassten Kameraden. Die erfahrenen Bergleute verstanden das als eine legitime und notwendige Maßnahme „bergmännischer Erziehung“. Es war oft ein drastischer, manchmal belehrender, aber meist humorvoller Vorgang.
Die Streiche unter Tage wurden nur weitererzählt, wenn die Bergleute unter sich waren. Martin Lotter, der Wirt des Gasthauses „Zum Bartl“, der als Junge oft beim Stammtisch der Bergleute bedienen musste, bestätigte dies. Waren die Kameraden unter sich, zogen sie sich gegenseitig mit ihren Streichen auf. Die Unterhaltung stockte aber sofort, wenn ein Nicht-Bergmann an den Tisch oder in Hörweite kam. Auch die Spitznamen wurden gehütet. Im Bergknappenverein gibt es darüber bis heute eine Liste. Die konnte jedermann lesen. Wer hinter den Namen stand, ist daraus aber nicht zu entnehmen und wird auch nicht weitergegeben. Diese ungeschriebene Regel unter den Kameraden gilt noch heute.
Durch die Aufzeichnung der Spitznamen und Streiche soll aber keinesfalls der Eindruck entstehen, die Bergleute hätten nur Unfug im Sinn gehabt. Beide waren ein Teil der Lebenswirklichkeit, so wie die harte Arbeit, die allgegenwärtigen Gefahren und die einzigartige Kameradschaft in diesem Beruf. Sie ermöglichte es auch, dass Streiche und Spitznamen – von wenigen Ausnahmen abgesehen – akzeptiert wurden und den Zusammenhalt in keiner Weise beeinflussten. Dazu gehörte allerdings, wie schon erwähnt, dass all diese Dinge unter den Kameraden blieben und nicht nach außen getragen wurden. Ausführliche Informationen zu den Spitznamen findet man in der letzten Ausgabe des Taschenbuches „Der Eisengau“ von 2021, erhältlich im Buchhandel.
Woher die Namen und Geschichten sind?
Die Spitznamen und ihre Geschichten dazu sind teilweise über 100 Jahre alt. Meine Sammlung begann, wie erwähnt, in den Achtzigerjahren. Da saß ich mit Männern aus meiner Nachbarschaft am Feuerhof zusammen und zeichnete auf, was sie erzählten.
- Der Wismet Haane, genannt Weiherblasch, wegen seiner hellen Haare,
- der Kohl Fritz, genannt „Schneck“ weil er aus Eschenfelden kam,
- der Rösel.., genannt Raisl Gockl, weil er oft einen roten Kopf hatte,
- der Pirner Johann, genannt Pfeiferlsteiger, weil er in der Feuerwehrkapelle Großenfalz die Klarinette spielte, und der Stöcklmeier Johann, genannt Spöttlmeier.
Natürlich konnte auch mein Vater einiges beitragen. Denn sein Großvater war fast 6 Jahrzehnte am Etzmannsberg tätig und zwei seiner Söhne schlugen ebenfalls die Steigerlaufbahn ein.
Nach 2012 traf ich wieder mit Bergleuten zusammen, bin im Bergknappenverein aktiv und erfahre so weitere Begebenheiten. Das Schöne ist, wenn mehr als zwei Bergleute zusammensitzen, sind die „alten Geschichten“ nicht weit. Denn auch nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich die Mentalität unserer Bergleute nicht grundlegend geändert. Ab der Einfahrt in den Schacht kamen sie in eine andere Welt. Sie gingen bis zu einer halben Stunde zu Fuß zu ihrem Arbeitsort. Dort arbeiteten sie zu dritt oder viert zwischen acht und 12 Stunden auf engstem Raum zusammen. Da blieb nichts verborgen, egal ob jemand kränkelte, nicht ausgeschlafen war, oder familiäre Probleme hatte. Die Männer waren oft über Jahre aufeinander eingespielt, jeder konnte sich auf den anderen verlassen. Jeder kannte seine Arbeit und das Können der anderen genau.
Nach der Schicht machten sich die einzelnen Gruppen gemeinsam auf den Rückweg, duschten alle nackt im Waschraum. Jeder hatte seinen „Buckelwäscher“, der ihm den Rücken schruppte. Dann gingen alle in die Kaue, zogen die verschmutzte Arbeitskleidung aus und die Straßenkleidung an. Mit dem Verlassen der Kaue und dem Abgeben der Marke ging es zurück in die bürgerliche Welt.
Bei näherer Betrachtung wird klar, dass sich der Arbeitsalltag unserer „Oarzgrowa“ deutlich von dem anderer Arbeiter unterschied. In der Maxhütte war man, vielleicht mit Ausnahme am Hochofen oder an den Walzen, nicht so aufeinander angewiesen. Die Arbeiter duschten nicht gemeinsam, ließen sich von niemand den Rücken schrubben und zogen sich nicht nackt in einer großen Halle um. Sie fuhren nicht gemeinsam mit dem Förderkorb ein und gingen nicht in kleinen oder großen Gruppen zu ihrem Arbeitsplatz.
Allerdings, es wäre grundfalsch, den Bergmannsberuf als etwas Besonderes zu stilisieren. Bergbau war nie romantisch. Er war immer Knochenarbeit, schmutzig und gefährlich. Nahezu jeder Bergarbeiter hatte irgendwann einmal einen größeren oder kleineren Unfall. Sei es, dass er sich die Hand einzwickte, in Schwimmsand geriet, oder im schlimmsten Fall verschüttet wurde. Die Arbeit war nicht immer schlecht bezahlt und hatte eine gute soziale Absicherung. Aber reich geworden ist kein Bergmann. Romantisiert wurde der Bergbau nur von den Dichtern (z. B. Goethe, Novalis und anderen). Sie waren wohl von ihren Bergwerksbefahrungen tief beeindruckt – wie ich auch.
Das Gleiche gilt für den Stolz der Bergleute. Außer bei den Aufmärschen in Sulzbach, wo sie in den sechziger Jahren, in schier endloser Marschformation, durch Sulzbach zogen, war von einem Stolz der Oarzgrowa nicht viel zu spüren. Es gab sie schon, die selbstbewussten und von den Kameraden geachteten Bergleute. Aber die hatten dann oft schon eine herausgehobene Stellung, als Leitungsperson im Bergbau, als Betriebsrat, oder als Stadtrat.
Eines ist aber zum Schluss ausdrücklich festzuhalten. Die Kameradschaft unter unseren Bergleuten war einzigartig. Das beteuerte jeder, mit dem ich gesprochen habe. Vor allem aber jene, die nach dem Ende des Bergbaus in Maxhütte oder Rohrwerk weiterbeschäftigt wurden, erinnern sich gerne an ihre Tage in der Grube: „So a Kameradschaft wai aaf da Groum houts aaf da Hittn niat geem!“. Was liegt näher, als alles festzuhalten, so lange es noch aktive Kameraden gibt.
© Helmut Heinl 3/2022

