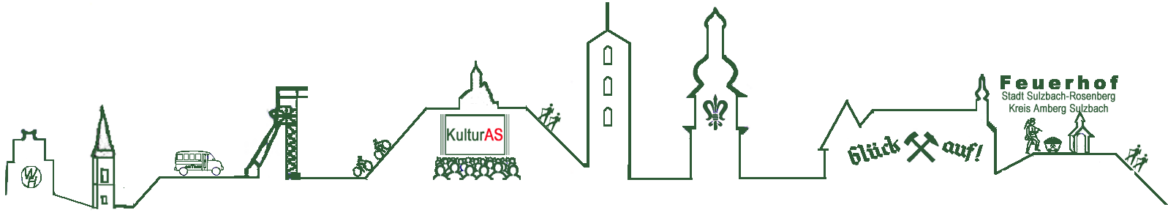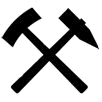
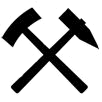 Ehemaliger Maxhütten-Arbeitsdirektor Manfred Leiss
Ehemaliger Maxhütten-Arbeitsdirektor Manfred Leiss"Bergbau, Maxhütte, Sozialgeschichte"
Wohlwollen der Obrigkeit gegenüber dem Bergbau
Der größte Förderer des Bergbaus und des Handels in Sulzbach war Kaiser Karl IV. Im Jahre 1359 erhielt die Stadt die Erlaubnis im ganzen Sulzbacher Gebiet Bergwerke zu errichten; sie wurden von allem Zoll in Böhmen befreit und waren mit Zollfreiheit in den Städten Prag, Breslau, Kuttenberg, Frankfurt/M und Nürnberg ausgestattet. Eine wichtige Urkunde ist die von Kaiser Karl IV. von 1373, in der es heißt, dass die Sulzbacher überall im Lande, das zu Sulzbach gehört, Bergwerke betreiben können gegen eine Entschädigung des Grundeigentümers „nach Schätzung treuer, würdiger, frommer(ehrlicher) Leute“. Georg Agricola verteidigte gegenüber denen, die vom Berg-und Hüttenwesen schändlich reden, den Bergbau als ehrliches Gewerbe: „ Sicherlich kann, da es eines der zehn größten und besten Dinge ist, viel Geld auf gute Weise zu bekommen, dies ein eifriger und fleißiger Mensch auf keine andere Weise leichter erreichen, als durch den Bergbau.“
Karl IV., verschaffte dem Sulzbacher Erz zollfreie Absatzgebiete bis nach Böhmen und wandte sich entschieden gegen den Anspruch der Amberger, die den „Falzberg“ für sich beanspruchten. Der Versuch der Amberger, den Sulzbachern die Vils als Transportweg zu versperren, ist Ausdruck dieses Konflikts. Auch im Wechsel der Herrscher über Sulzbach wurden alte Abbaurechte und Zollfreiheiten erneut bestätigt.1432 erhielt jeder Stadtbürger das Recht in der Herrschaft Sulzbach nach Erz zu graben.
Der Bergmannsberuf an der Spitze der Lohnskala
Mit den von den Landesherren den Bergleuten gewährten Privilegien entstand im Mittelalter ein freier Bergmannsberuf; die Bergleute genossen Freizügigkeit, bei „freiem Geleit“ und Niederlassungsfreiheit mit ihren Familien, damit die Landesherren für neu entdeckte Lagerstätten auch genügende Fachleute zur Verfügung hatten. Gemessen an den Verdiensten der Handwerker stand der Bergmann an der Spitze der Lohnskala; 1537 wurde ein Jahresverdienst von 25 Gulden notiert. Eine sparsam lebende Familie kam mit 15 Gulden im Jahr aus und für 250 Gulden konnte man ein Steinhaus kaufen.
Mit der Urkunde vom 18.06.1460 genehmigte Papst Pius II. auf Bitten der Stadt Sulzbach, Diözese Regensburg, die kontinuierliche Arbeitsweise, „in besonderer Gnade, dass sie (die Bergleute)zur Aufrechterhaltung des besagten Bergwerks an den genannten Tagen(Feiertagen) daselbst arbeiten, die Wasser herausleiten und wegpumpen und andere notwendigen Arbeiten verrichten dürfen und dass diesen erwähnten Arbeitern in den erwähnten Gruben, falls etwa welche das Leben einbüßen sollten, das kirchliche Begräbnis nicht verweigert werde, vorausgesetzt, dass sie nicht im Bann (Exkommunikation) sind oder sonst sich öffentlich und offenkundig als Widersacher der Kirche und ihrer Verordnungen erweisen.“
Herzog Albrecht IV verkaufte 1475 und 1478 seinen Erzzehnt auf einige Vorkommen an Sulzbacher Bürger. Der Dreissigjährige Krieg (1618-1648) vernichtete den Erzbergbau und die Eisengewinnung
in der Oberpfalz fast vollständig. Neben den direkten Einwirkungen des Krieges und den Bevölkerungsverlusten trug dazu- wie schon erwähnt-, auch die Ausweisung der Protestanten bei, unter denen sich Hammerherren und Fachleute des Berg- und Hüttenwesens befanden.
Die Erneuerung der Hammereinigung scheiterte 1655 am Widerstand des Herzogs von Sulzbach, da der bayerische Kurfürst seinen neuen Hochofen bei Fichtelberg nicht einbringen wollte. Trotz der totalen Verarmung der Region brachten die Landesfürsten den Bergbau und die Eisenhütten wieder in Gang und es entstand der erste Hochofen zu Königsbrunn, der 1717 wegen besserer Rohstoffbedingungen nach Weiherhammer verlegt wurde. Trotz allem, der Oberpfälzer Bergbau und das Hüttenwesen konnte sich auch wegen veralteter technischer Verfahren kaum erholen. Von England ausgehend bahnte sich eine Umwälzung der Eisenhüttentechnik an, durch die Erfindung der Dampfmaschine, die Verwendung des Kokshochofens und das Walzen von schmiedbarem Eisen. Mit der ersten Eisenbahn Nürnberg-Fürth (1835)und damit verbundenen Absatzerwartungen an Eisenbahnbedarf, keimte noch mal Hoffnung auf in der Oberpfalz, die seit 1806 im Königreich Bayern aufgegangen war.
Minderung der Feyertage
Schon mit den Bergordnungen vor der Reformation versuchte man gegen die vielen Feiertage vorzugehen, besonders auch gegen den „ blauen Montag“. Wer die erste Schicht nach einem Feiertag versäumte, durfte die ganze Woche nicht in den Berg einfahren.
Mit dem 1783 erlassenen „Edikt wegen Abstellung einiger Missbräuche besonders des sogenannten Blauen Montags bey den Handwerkern“ hat der Preußen-König Friedrich dem Einhalt geboten.
Dass die von der Obrigkeit eingeräumten Feiertage offenbar missbraucht wurden, rief den Zorn von Karl Theodor zu Sulzbach hervor und führte am 14.01.1785 zu einem Dekret: „Wir Karl Theodor, ob wir gleich aus sehr erheblichen Ursachen gehofft haben, dass sich sämtliche unserer Unterthanen die vom päbstlichen Stuhl selbst verfügte Abstellung der gar zu übermäßigen Feyertage zu Nutzen zu machen, schien nach der geführt heilsamster Absicht an eben denselben der Arbeit obliegen würden, so hat uns aber bisher eine vieljährige Erfahrung des Gegenteils überzeugt, indem sich einige Inwohner der diesseitigen Kurlande aus Mangel einer ächten Kenntnis ihrer Pflichten und aus einem Scheineifer, die abgewürdigten Feyertage noch immer halten zu müssen.
Andere hingegen nicht aus Andacht oder Frömmigkeit, sondern bloß aus einem alten Hang zum Müßiggang und gewöhnliche Ausschweifungen noch fortfahren, dieselben nicht nur selbst feyerlich zu begehen, sondern sogar andere Personen von der Arbeit teils mit Schimpfworten und Bedrohungen abzuhalten…“
Es folgt dann eine Aufzählung der indizierten Feiertage: 24.02 Mathias, Osterdienstag, 24.04. Georgius, 15.Philipus und Jakobus, Pfingstdienstag, 22.06. Maria Magdalena, 02.07.Maria Heimsuchung, 25.07.Jakobus; 10.08.Laurentius, 24.08.Bartholomeus, 21.09. Mathias, 29.09. Michael Erzengel, 28.10.Simon et Jude, 11.11.Martinus, 21.11.Maria Opferung, 30.11 Andreas, 06.12.Nicolaus, 21.12.Thomas, 27.12. Johann Evang., 28.12.Unschuldige Kinder.
Ob sich die Untertanen dem unterworfen haben, ist nicht näher belegt.
Als Folge des großen Holzschlags machte der Freiherr von Bettschart 1786 den Vorschlag zur Schonung des Holzes Steinkohlen für „Kalch und Ziegeloffen“ zu gebrauchen, so berichtet die Sulzbacher Stadtchronik.
Offensichtlich wurde das Thema Nachhaltigkeit immer wieder aufgegriffen, als man z.B. sämtlichen Jägern befahl, wegen dem Rückgang der Eichenkulturen für die Anpflanzung von Eichen und Buchen mehr Sorge zu tragen. Ob da auf frühere Ideen zurückgegriffen wurde, ist nicht belegt. Der als Erfinder der Nachhaltigkeit geltende Berghauptmann Hans Carl von Carlowitz (1645- 1714), aus dem sächsischen Freiberg, schloß nach einer gründlichen Inventur der Wälder “ Sylviacultura oeconomica“ und einer umfassenden Reorganisation des Forstwesens sein Reformprojekt 1669 mit einer grande ordonance ab, mit der Maßnahmen zur Wiederherstellung und Erhaltung des Hochwalds vorgesehen waren. Er profitierte von den Erfahrungen Ludwig XIV in Frankreich, bei dem wie er vermerkt „das „ganze Summarium“ des eigenen Vorhabens zu finden sei. Die Nachhaltigkeitsidee, wo sie herangezogen wird, ist Ausfluss einer Krisensituation, so wie sie um 1700 im sächsischen Silberbergbau gegeben war. Dieser war das ökonomische Rückgrat Sachsens.
Das Schmelzen von Silber verschlang ganze Wälder und es drohte Holzmangel. Die Nachhaltigkeit ist nicht nur als billige Redewendung von Managern für betriebswirtschaftlichen Erfolg gebräuchlich geworden, sondern als ökonomisch-ökologischer Schlüsselbegriff unseres Jahrhunderts. Nachhaltigkeit darf nicht zum Plastikwort verkommen, sondern muss Leitidee bleiben wie es im Brundtland-Bericht definiert wurde, als Gebot, die Bedürfnisse in der Gegenwart nur in einer Weise zu befriedigen, wie es auch künftigen Generationen möglich sein soll.
Die Sulzbacher Chronik Nr.6210 enthält eine bemerkenswerte Protokollnotiz von 1801 über das Brennholz für Bergleute, die bis jetzt in Siebeneichen arbeiteten und dann nach Etzmannsdorf versetzt wurden. Wohl auf Geheiß des Bergschreibers sollten sie ihr Brennholz nun in den Königsteiner Waldungen holen. In ihrem Gesuch an die Stadt Sulzbach stellen sie fest: „Wir sind größtenteils arme Bergleute ,welche den ganzen Tag schwer arbeiten und vom täglichen Lohn leben müssen, es bleibt uns also auch keine Zeit übrig, dieses Holz mit Schubkärren herbeiführen zu können“. Und sie bitten, ihnen dies in den benachbarten, näheren Revieren Eichelberg oder Wagensaß angedeihen zu lassen.
Bekenntnis eines Schichtmeisters zum Bergwerksstand
Im Mai 1838 verpflichtete das königliche Bergamt Amberg gemäß Urkunde den Bürger und Gürtlermeister Johann Carl Leibig als Schichtmeister bei der Eisensteinzeche Skt. Anna zu Sulzbach, Etzmannsberg und Eichelberg. Den in der Bergordnung von 1784 vorgeschriebenen Schichtmeister-Eid hat Leibig wie folgt abgelegt und eigenhändig geschrieben :
„Ich Schichtmeister Karl Leibig, gelobe und schwöre, dass ich dem Allerdurchlauchtigsten König und Herrn Ludwig Karl August von Bayern, meinem allergnädigsten Herrn treu und gewärtig sein will, seiner kgl. Majestät und des gemeinen Bergwerks-Standes getreu fördern, Schaden warnen und abwenden, und meinem Amte das mir anbefohlen ist, und sonderbar auch auf meinem Gewerken getreu verfolgen; auch auf alles, womit ich ihren Nutzen fördern und vermehren mag, auf`´s höchste befleiße; nichts tun und nichts verhängen, was den Gewerken zum Schaden und Nachtheile gereicht; auch keine falschen Namen in die Rechnungen bringen, und mich allenthalben der Bergordnung gemäß unverbrüchlich halten; wenn ich selbe übergangen finde , an den gehörigen Orten warnen und ansagen, keinen Genuss oder Nutzen, der mir nicht zugelassen und verordnet ist;
in allem genannten, gegen welches mich auch keine Gabe, Genuss, Freundschaft oder Feindschaft bewegen soll; sondern ich will dieser alles nach meinem besten Vermögen halten, getreu und ohne Gefährde, so wahr mir Gott helfe, und sein Heiliges Evangelium.“
Der 1848 zwischen Jakob Eigner, Hammer- und Mühlbesitzer und Gottfried Eigner, vor dem Gutsherrn - Patrimonial - Gericht in Fronberg bei Schwandorf geschlossene Kaufvertrag, steht beispielhaft für Verkaufstransaktionen zu dieser Zeit. Die genannten Objekte erwecken den Eindruck, als seien landwirtschaftliche Gebäude und Flächen veräußert worden; tatsächlich ging es um Schmelzöfen und Eisenhämmer. Auf dem im Kaufvertrag erwähnten Gelände soll schon vor 400 Jahren ein Hammerwerk und eine Waffenschmiede bestanden haben.
Zu Beginn des 19.Jahrhunderts wurde zunächst ein Hochofenwerk, ein kleine Eisengießerei und ein Feineisenwalzwerk errichtet, zum Zeitpunkt des Besitzübergangs stillgelegt und durch einen Kupolofen ersetzt. Der Betrieb florierte unter Gottfried Eigner bis zu dessen Tod im Jahre 1887.
Das Werk, dazu eine 50 Tagwerk große Landwirtschaft und eine Villa, wurden dann von der Maxhütte aufgekauft; die Landwirtschaft und die Villa erwarb der aus Norddeutschland zugezogene Landwirt Kebbel. Das Feineisenwalzwerk wurde in 1895 stillgelegt. Die 1896 auf dem Werksgelände angesiedelte Achsenfabrik, musste wegen Absatzschwierigkeiten 1929 aufgegeben werden. Durch technische Innovationen erbrachte die Eisengießerei dann respektable Produktionsergebnisse; Fronberg gehörte ab 1934 zur Maxhütte Zwickau und mit weiterer Verbesserung der Gießtechnik erreichte man eine monatliche Kapazität von 300 to.
Im Juni 1869 erschienen vor dem Notar in Bayreuth der königliche Advocat und Hofrath
von Kerstorf aus Augsburg, der Rentier Olivier Goffard und der Bergbau Consulent Friedrich
Graeser, um die Bewilligung zur Berichtigung des Besitztitels protokollieren zu lassen.
Die Genannten besaßen zu diesem Zeitpunkt gemeinschaftlich folgende Eisensteinzechen: “Valentin“ bei Muckenreuth mit einem Grubenfelde von einer Fundgrube und sechzig Maasen, “Maximilian“ bei Leutzenhof mit einem Grubenfeld von einer Fundgrube und siebzig Maasen, die konsolidierte
Grube“ Friedrich“ bei Sassenreuth mit einem Grubenfeld von einer Fundgrube und einhundertachtzig Maasen, die konsolidierte Grube“Leonie“ bei Auerbach mit einem Grubenfeld von einer Fundgrube und dreihundertfünfzehn Maasen.
Nach dem bereits bei der Muthung 1857 (sh.auch Bergbau der Maxhütte) festgestellten Zustand war der wirkliche Besitzstand so: von Kerstorf, Besitzer der Hälfte; Goffard Besitzer von zwei Sechsteln und Graeser Besitzer von einem Sechstel. Um dem im Juli 1869 eingeführten Berggesetz zu entsprechen, vereinbarten die Beteiligten den Besitzstand im vorgenannten Verhältnis formell zu vollziehen. Gleichzeitig kamen sie überein, dass von Kerstorf fünfzig Kuxe, Olivier Goffard dreißig und Graeser siebzehn Kuxe erhalten.
Nach der notariellen Genehmigungserklärung haben im August 1872 die Herren von Kerstorf und Graeser verschiedene Bergwerksobjekte an die Firma Klett & Co, Nürnberg für zwanzigtausend Gulden verkauft.
© Manfred Leiss