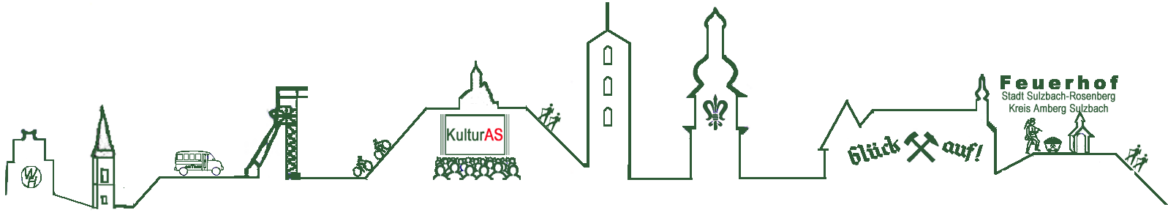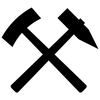 Begriffe aus dem Bergbau in Sulzbach-Rosenberg
Begriffe aus dem Bergbau in Sulzbach-RosenbergEine Auswahl historischer und gebräuchlicher Begriffe aus dem Alltag der Bergleute, die Ihnen nicht geläufig sind, möchten wir Ihnen erklären was diese schließlich bedeuten oder aussagen.
Sollten Sie weitere Begriffe kennen, schreiben Sie uns. Wir werden unsere Liste vervollständigen.
A | |
Abbau | planmäßige Gewinnung von Erz |
In der Vorstellung der Bergleute aus alter Zeit war die Erde über und unter Tage von Lebendigem durchwoben. | |
| auch Bergmannsklo genannt: Behälter mit verschließbarem Deckel zur Verrichtung der Notdurft unter Tage. | |
Abraum | Im Tagebau das die Lagerstätte überdeckende Gestein, von abräumen. |
Absaufen | voll Wasser laufen |
Abteufen | Herstellen eines Schachtes von oben nach unten (Schacht, Blindschacht). In die Teufe (Tiefe) vordringen. |
| Abwetter | Die Abwetter (verbrauchte Luft) wurden über den Luftschacht ausgeblasen. |
Alter Mann | Verlassener, abgesperrter, versetzter oder zu Bruch geworfener Grubenbau. |
Anschläger | Gab dem Maschinisten Signale für die Bedienung des Förderkorbes. Anschläger hieß er, weil die Signale ursprünglich mit einer Glocke gegeben wurden. |
| Arschleder | Gesäßschutz aus Leder |
| Aufbruch | von unten nach oben hergestellter Blindschacht |
| Aufwältigen | einen zusammengebrochenen Grubenbau wieder benutzbar machen |
B | |
4. Dezember, Festtag zu Ehren der heiligen Barbara, Schutzpatronin der Bergleute | |
ist eine der geschichtsträchtigsten Ferienstraßen der Bundesrepublik Deutschland, verläuft von Pegnitz im Norden nach Regensburg im Süden. Sie verbindet die einstigen Eisenzentren Ostbayerns, die Reviere Pegnitz, Auerbach, Sulzbach-Rosenberg und Amberg. | |
| Befahrung | Besichtigung eines Bergwerks |
Bergamt | Für den Bergbau zuständige staatliche untere Aufsichtsbehörde. |
Sammelbegriff für alles, was mit dem Gewinnen, Fördern und Veredeln nutzbarer Bodenschätze dient | |
Der Sulzbacher Bergbaupfad ist eine der Stationen an der Bayrischen Eisenstraße. Die Oberpfalz war seit dem 13. Jahrhundert durch ihre Vorkommen an Eisenerz und Braunkohle eines der wichtigsten Eisenzentren Mitteleuropas und wird auch "Ruhrgebiet des Mittelalters" genannt. Der Bergbaupfad verbindet die ehemaligen Tagesanlagen der Erzgruben und den Schaustollen "Max" entlang der Arbeitswege der damaligen Bergleute. | |
Dieser Stollen wurde von Bergleuten zwar in einem ehemaligen Luftschutzstollen angelegt. Sie erhalten aber hier einen Eindruck wie es in den Strecken der hiesigen Gruben ausgesehen haben mag. Einiges Gezähe, das ist das Werkzeug der Bergleute, vermitteln Ihnen einige Eindrücke des Berufes des Bergmanns. | |
ist die Berufsbezeichnung eines Menschen, der in einem Bergwerk Rohstoffe abbaut | |
| Bergmannsgruß | Traditioneller Gruß, den Bergleute verwenden, wenn sie in die Grube oder von der Grube zurückkehren. |
| Bergmannslied | Das Steigerlied (auch Steigermarsch oder Glück auf, der Steiger kommt) ist ein deutsches Bergmanns- und Volkslied |
Bergmannswege gab es eigentlich nicht. Jedenfalls wurden sie nicht als solche bezeichnet. | |
ursprünglicher Name für den Bergmann. Später Bezeichnung für den Gesellen des Meisters (Hauers). Nach 1945 ein offizieller Lehrberuf mit einer Knappenprüfung nach 3jähriger handwerklicher und bergmännischer Lehre. | |
Im Jahre 1898 spielte dann die Bergknappenkapelle zum ersten Mal zum Bergball auf, zwischenzeitlich ist sie seit… die offizielle Stadtmusikkapelle | |
Vertretung der Arbeitnehmerinteressen und der sozialen Absicherung der Bergleute | |
| Bergmannskleidung | die Tracht der Bergleute, ist eng mit der Geschichte des Bergbaus verbunden und ist auch heute noch ein Symbol für die harte und gefährliche Arbeit der Bergleute. Der schwarze Stoff steht für die Dunkelheit im Stollen, die goldenen Knöpfe symbolisieren das Licht der Sonne. |
| Bergsenkung | Begriff im Bergbau, der auf das Absinken oder die Senkung des Bodens oder der Oberfläche in einem Bergwerk oder in dessen Umgebung hinweist |
unterirdische Anlage zur Erschließung und Ausbeutung von Bodenschätzen. Umfaßt die Gesamtheit aller über- und untertägigen Objekte. | |
Im März 1960 legten 7.500 Arbeiter der Maxhütte ihre Arbeit nieder, als die Unternehmensleitung aus Gründen der Arbeitssicherheit den Bierkonsum einschränken wollte. Der Ende des Streiks erfolgte 32 Stunden später, als der bayerische Arbeitsminister Walter Stain unter den Parteien vermittelt hatte. | |
Blechlmaa´ | Der Mann, der die Einfahrtsmarken der Bergleute entgegennahm und aufbewahrte, bis sie nach dem Ende der Schicht wieder auffuhren. |
| Blindschacht | nicht an den Tag führender Schacht |
| Bruch | planmäßig oder unplanmäßig zerstörte Grubenräume |
Bruchfeld | nennt man jene Gebiete der Tagesoberfläche, die durch den Abbau des Erzes eingebrochen sind. Hier bildeten sich Trichter und Spalten. Diese Bruchgebiete durften aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden |
Buckelwäscher | gibt es, seit in den Sulzbacher Erzgruben Wasch- und später Duschgelegenheiten bereitgestellt wurden. Der Buckelwäscher war ein Kollege, mit dem man sich gut verstand und von dem man sich nach der Schicht den Rücken waschen ließ. Im Ruhrbergbau hieß das „Buckeln“. So geht es mit vielem aus dem Bergmannsalttag: Was für viele selbstverständlich war, gerät einfach in Vergessenheit. |
D | |
Eine Spezialität der Bergmannsprache in den Sulzbacher Gruben -und nur dort- ist die Bezeichnung für das Örtchen. Es hieß seit Generationen „Daniel“. Woher dieser Ausdruck kommt ist nicht zu erfahren, selbst die ältesten Bergleute mit denen ich sprach, kannten nur diesen Ausdruck. Mit dem biblischen Daniel hat er nichts zu tun. Im 5. Buch Mose, Kap. 23 gibt es zwar eine klare Anweisung für ähnliche Verrichtungen, aber da ist von Daniel nicht die Rede. Es handelte sich dabei um einen größeren, ca. 100 L fassenden, meist verzinkten Kübel mit Deckel. Der Kübel hatte einen Bügel, so dass er mit einem Seil hochgezogen werden konnte. Er stand in der Regel etwas abseits, in einem Verschlag, in dem die Bergleute ungestört ihr Geschäft verrichten konnten. Der Kübel wurde regelmäßig nach über Tage gebracht und ausgeleert. Beauftragt wurden damit meistens Kameraden, die irgendwelche Verfehlungen begangen hatten, wie z.B. zu spät zur Schicht gekommen, unter Tage geraucht. (Helmut Heinl) | |
Deputatholz | festgelegte Mengen an Brennholz, das die jeweiligen Bezugsberechtigten unentgeltlich erhielten. |
Deputatkohle | das war ein Kohlenkontingent, das die Bergleute von der Grubenverwaltung für den Eigenverbrauch zugewiesen erhielten. |
 Der „Deutsche Bergmannstag“ ist die höchste Festveranstaltung der deutschen Berg- und Hüttenleute. Er findet im Abstand von 3 bis 4 Jahren an unterschiedlichen Bergbaustandorten der Bundesrepublik statt. Der 11. Deutsche Bergmannstag war vom 6. bis 8. Juli 2007 in Sulzbach-Rosenberg Der „Deutsche Bergmannstag“ ist die höchste Festveranstaltung der deutschen Berg- und Hüttenleute. Er findet im Abstand von 3 bis 4 Jahren an unterschiedlichen Bergbaustandorten der Bundesrepublik statt. Der 11. Deutsche Bergmannstag war vom 6. bis 8. Juli 2007 in Sulzbach-Rosenberg | |
Deutscher Türstock | Türstock (Stollenausbau) mit Verblattung von Stempeln und Kappe gegen Stoßdruck (Seitendruck) |
| Direktor | durfte sich in der Maxhütte nur nennen, wer mehrere Bergwerke leitete |
| Durchschlag | Stelle,an der zwei aufeinanderzulaufende Stollen zusammentreffen |
E | |
alter bergmännischer Ausdruck für Mineralaggregate oder Gesteine, aus denen Metalle oder Metallverbindungen hergestellt werden können. | |
| Der Heimatverein war 1950 von Bergleuten und Arbeitern des Stahlwerks Maxhütte gegründet worden. | |
| Erzbarometer | spezielles Barometer für Grubenneulinge. |
Der älteste Bergbau der Welt, war ursprünglich auf die Gewinnung von Edelmetallen wie Gold und Silber ausgerichtet. | |
Erzhülle | ist eine Folgeerscheinung des Erzabbaus. Aufgrund der Erzförderung sackten die überlagernden Schichten bis unterhalb des Grundwasserspiegels ab, so dass der Teich entstand. |
| Als in den Sulzbacher Gruben noch mit Presslufthämmern gearbeitet wurde, musste das hereingewonnene Erz in die Hunte geschaufelt werden. Neben sehr hartem Erz gab es Stellen mit ganz lockerem Rieselerz, das wie lockerer Kies herausfloss. Erzmüller machten sich diesen Umstand zunutze. Die Deckbretter, oben an der Firste wurden etwas gelockert, und zwar so, dass ein Spalt entstand. Dann wurde der Hunt darunter geschoben und mit einer Eisenstange durch die Bretter gestochert. Das Erz rieselte, von der Firste herab, gleich in den Wagen. Es wurde „gemahlen“. So war es leicht, die im Gedinge vereinbarte Erzmenge herein zu gewinnen, auch wenn das „Mahlen“ streng verboten war, aus gutem Grund. Der entstandene Hohlraum konnte jederzeit einstürzen und verheerende Schäden verursachen. | |
| Erzweg | Der Erzweg durchzieht das Amberg-Sulzbacher Land und eignet sich hervorragend für einen Wanderurlaub. |
| Ewige Teufe | unbegrenzte Tiefe |
F | |
| Fäustel | schwerer Handhammer mit zwei Schagflächen |
| Fahren | jede Art der Fortbewegung der Menschen unter Tage |
Fahrweg | Fußweg, denn die Bergleute vom Schacht zu ihrem Arbeitsplatz zurückgelegten. Denn Bergleute gehen nie, sondern fahren. |
| Firste | obere Begrenzung des Grubenbaus |
| Firstenbau | Abbauverfahren in geneigter Lagerung |
| Flöz | Eine horizontale Schicht von Erz oder Gestein in einem Bergwerk. |
| Förderkorb | Noch heute gültiger Begriff aus dem historischen Bergbau. Das erste Fördergefäß im Schacht war ein Korb am Seil, später ein Kübel oder eine Tonne; |
| Förderkübel | Fördergefäß aus Holz, das im frühen Bergbau zur Förderung von Erz, Kohle oder Haufwerk eingesetzt wurde. Heute aus Stahl, wird beim Schachtabteufen verwendet (Abteufkübel). |
bezeichnet man eine Konstruktion, die über dem Schacht errichtet wird. Der Förderturm des 1974 stillgelegten St.-Anna-Schachtes ist ein Sulzbach-Rosenberger Wahrzeichen und ein Identifikationsobjekt für die Bewohner. | |
| Franz Beckenbauer | Sulzbach-Rosenbergs „erster Bergmann“ |
| Friedrich Flick | Flick erwarb in den 1920er und 1930er Jahren eine bedeutende Position in der deutschen Wirtschaft. Er übernahm unter anderem die Leitung der Maxhütte AG, einem großen Stahl- und Bergbauunternehmen mit Sitz in Sulzbach-Rosenberg in Bayern. Unter seiner Führung entwickelte sich die Maxhütte zu einem der größten Stahlproduzenten Deutschlands. |
Öllampe, in einer Frosch-ähnlichen Form. Über Jahrhunderte das einzige Licht des Bergmanns unter Tage. | |
Fuder | altes Raummaß, entsprach etwa einer Wagenladung. 1 Fuder = 4,05 Kubikmeter. |
G | |
| Gang | mit Erzen oder anderen Materialien ausgefüllte, meist steil einfallende Kluft (Ader) |
Gebirge | Als Gebirge wird in der Bergmannssprache das Gesteins- oder Erdreich bezeichnet, in das Bergwerke (Schächte, Stollen, etc.) getrieben werden. Dabei wird das oberhalb der Lagerstätte gelegene Gestein auch als „Deckgebirge“ oder „Hangendes“, das unterhalb gelegene als „Liegendes“ bezeichnet. |
| ausgehandelter Akkordlohn im Bergbau | |
Gewerke | Mitglied einer bergrechtlichen Gewerkschaft (Besitzer von Kuxen/Anteilen) |
| Gewinnung | nutzbares Mineral aus dem Gebirgsverband lösen |
Geleucht | Bezeichnung aller Arten von Grubenlampen |
Gezähe | das Handwerkszeug der Bergleute. |
Gruß der Bergleute, als hoffnungsspendendes Symbol in der Welt zwischen Dunkelheit und Licht | |
Groum | Grube |
Grube | Gesamtheit aller untertägigen künstlichen Hohlräume (Grubenbaue) eines Bergwerks. |
Grube Caroline | Namensgeberin war: Caroline, Friederike, Wilhelmine; Bayerische Königin *1776 + 1841 1886 Bau des ersten Schachts der Erzgrube "Caroline" in Sulzbach 1888 Bau einer Seilbahn zur Erzgrube "Caroline" in Sulzbach 1902 Wassereinbruch in Grube "Caroline" in Sulzbach 1917 Brand in Grube "Caroline" |
Grube Eichelberg | Grube Eichelberg bis 1977 |
Grube Etzmannsberg | Auf „Etzmannsberg” nahm 1871 ein neuer Schacht die Förderung auf. |
Grube Fromm | 1926 Stillegung der Erzgrube "Fromm" |
Grube St. Anna | Annaschacht bis 1974 |
| Grubengebäude | Im Bergbau bezieht sich der Begriff "Grubengebäude" auf alle miteinander verbundenen unterirdischen Hohlräume (Grubenbaue) eines Bergwerks. |
| Grubenhobel | Wer neu in das Leben unter Tage aufgenommen wurde, musste sich in jedem Fall erst einmal einer eingehenden sozialen Kontrolle unterziehen. |
| Im Sulzbacher und im Auerbacher Bergbau erhielten die Bergleute vom Steiger Brennholz zugewiesen. Meistens handelte es sich um Grubenholz, das beim Ausbessern des Ausbaus und beim „Rauben“ anfiel. | |
Grubenlampe | ist eine Leuchte, die bei der Arbeit unter Tage eingesetzt wird. |
| Grubenriß | Kartografische Darstellung des Grubengebäudes |
| Ein Grubentelefon ist ein spezieller Telefonapparat, der auf die harten Bedingungen unter Tage ausgelegt ist. Diese Geräte sind wasserdicht und schlagfest konstruiert. Die Modelle im Sulzbacher Bergbau waren aus Gusseisen hergestellt und hatten dadurch ein Gewicht von ca. 15 kg. Der Hörer hing an einer Panzerschnur. Das lautstarke Läutewerk machte sie auch bei großem Umgebungslärm gut hörbar. | |
| Grubenwehr | Rettungstrupp im Bergbau, besteht aus freiwilligen, besonders qualifizierten Bergleuten, |
| Grubenwehr-Signale | 1 Schlag = Halt 2 Schläge = Vorwärts 3 Schläge = zurück 5 Schläge = Ist alles wohl? 2 x 2 Schläge = Notsignal |
| Grubenwetter | Luft |
Gschpia | aus Kanthölzern und Brettern |
H | |
Haiferlstauan | Heckenrosen daraus konnten die Siedlerfrauen im Herbst aus den Früchten Marmelade kochen. |
| Halde | übertägige Aufschüttung von taubem Gestein oder Schutt |
Hammer Philipsburg | Karl IV., ein Gönner Sulzbachs, förderte die Erz- und Eisengewinnung durch weitere Schürf- und Zollfreiheit. 1366 wurde Friedrich Kastner das Recht verliehen auf einer Holzmühle in Rosenberg einen Eisenhammer zu errichten und die „Rosen“ als Wahrzeichen zu führen. Dieser „Hammer Philipsburg” produzierte bis 1738. |
Hauer | Berufsbezeichnung für eine Fachkraft unter Tage |
| Haufwerk | aus dem Gebirgsverband gelöstes Gestein oder Mineral |
| Heilige Barbara | Sie steht für Standhaftigkeit im Glauben,weil sie der Legende nach von ihrem Vater in einen Turm gesperrt und dan enthauptet wurde, weil sie sich weigerte ihren christlichen Glauben aufzugeben.Sie gilt bis heute als Schutzpatronin der Bergleute |
| Um diese Traditionen für nachfolgende Generationen zu bewahren, erzählt Helmut Heinl, in kurzen, amüsanten bis lehrreichen Geschichten, wie das Leben unter Tage in den letzten 150 Jahren war. Sein Anliegen ist es, die Werte und Traditionen der Erzgräber nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Die Geschichten stammen von Gesprächen mit Zeitzeugen und eigenen Recherchen, die er seit 1983 dokumentiert." | |
| Hochofen | Ein Hochofen ist ein Ofen, der zur Herstellung von Roheisen verwendet wird. Roheisen ist ein Ausgangsmaterial für die Produktion von Stahl. Der Ofen ist normalerweise zwischen 30 und 60 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 5 bis 15 Metern. |
| Hundestößer | Schlepper, der die Hunte bewegt (auf den Hund gekommen) |
offener Förderwagen | |
I | |
| Inaugenscheinnahme | Fundbesichtigung durch das Bergamt |
K | |
Kapo | Vorarbeiter, meistens ein erfahrener Hauer, der den Steiger unterstützte. Eingesetzt z.B. zur Kontrolle bestimmter Arbeiten. Der Fahrhauer z.B. war ein erfahrener zuverlässiger Hauer, der als Hilfssteiger tätig war. Er meldete dem Steiger, dass alle Bergleute ordnungsgemäß ein - und ausgefahren waren. |
Karbid | chemisches Mittel, künstlich hergestellt, mit Wasser vermischt erzeugt Karbid das hell brennende Azetylengas für die Karbidlampe |
Karbidlampe | Die bis zum Ende des 19. Jahrhunderts im Bergbau gebräuchlichen "Frösche" wurden mit Lampenöl betrieben. Sie wurden von den Karbidlampen abgelöst, die ein warmweißes, gleichmäßiges Licht erzeugten, das für die Arbeit unter Tage sehr gut geeignet war. Erst neueste LED-Techniken ermöglichen ähnliche Ausleuchtungsgrade. Die Flamme entsteht durch die Verbrennung von Azetylen-Gas, das im Lampenkörper dadurch entsteht, dass Wasser auf Karbid (Calciumkarbid CaC2) tropft. |
| "A.D. 1988, St. Barbara bitt`für uns", heißt es in kunstvoll angebrachten Lettern über dem Portal der kleinen Kapelle am Feuerhof beim Bartl-Dreieck, und dieser Ruf zur Schutzheiligen der Bergleute ist mehr als nur ein frommer Brauch. | |
Kaue | Umkleideraum der Bergleute |
| Kerbholz | paarweise gleichzeitig eingekerbte Holzstäbe zur Kontrolle von Abrechnungen Stab mit Namen der Geschworenen, der einem vorzuladenden Bergman zugeschickt wurde (etwas auf dem Kerbholz haben) |
benannt nach dem langjährigen Aufsichtsrat Max von Klenze 1912 Bau des Klenzeschachts im Revier Sulzbach | |
| Kluft | Gebirgsspalte |
| Eine Knappschaft ist ein organisatorischer Zusammenschluss der in einem Bergwerk oder in einem Revier beschäftigten Bergleute mit dem Ziel der Arbeitnehmerinteressenvertretung und der gegenseitigen sozialen Absicherung. Der Begriff leitet sich von einem Zusammenschluss von Knappen her. Wikipedia | |
| Konverter | Ein Konverter ist ein Ofen, der zur Herstellung von Stahl aus Roheisen verwendet wird. Der Konverter ist eine große, zylinderförmige Struktur, ähnlich wie der Hochofen, der aber eine andere Funktion hat. Im Gegensatz zum Hochofen, der Roheisen produziert, wird im Konverter Roheisen in Stahl umgewandelt. |
| Kübel | Fördergefäß zum Schachtteufen |
Kumpel | stammt vom lateinischen „companio“, wörtlich übersetzt „Brotgenosse“, also „Kollege, mit dem man die Mahlzeit teilt.“ |
| Kuxe | Anteil am Vermögen einer bergrechtlichen Gewerkschaft in Form eines Namenspapiers |
L | |
| Lachter | Längemaß (2,0924 m) |
| Lehrhauer | unter Aufsicht eines Hauers arbeitender Bergmann |
Manfred Leiss langjähriger Arbeitsdirektor der Maxhütte. Leiss liegen die Tradition des Bergbaus in und das Montanwesen sehr am Herzen | |
Luftschutzstollen | ist ein unterirdischer Hohlraum, der in Kriegszeiten den Menschen als Schutzraum gegen Luftangriffe diente. |
| Lutte | Kanal oder Röhre zur Abführung von Wasser bzw. zur Bewetterung |
M | |
| Mächtigkeit | Dicke einer Lagerstätte |
| Malter | altes Raummaß (ca.0,3 t) |
Markscheider | Vermessungstechniker, der unter (und über) Tage die Grubengrenzen festlegte und die Meßergebnisse im Grubenriss s. Kommentar kartographisch festhielt. |
| benannt nach dem bayerischen König Maximilian II. Joseph, war das traditionsreiche Hüttenwerk, das im Ortsteil Rosenberg die Arbeit aufnahm. | |
| Mundloch | Tagesöffnung eines bergmännischen Baus (Stollen, Tagebetrieb, Schacht) |
Muten | die Verleihung einer Berechtsame, eines Grubenfelds beim Bergamt beantragen |
O | |
Oarzgrowa | Mundart-Ausdruck für Erzgräber. |
| Ort/Örter | das Ende einer Strecke |
Ortsältester | Der verantwortliche Hauer an den einzelnen Betriebspunkten. Er war Sprecher der Bergleute an einem Abbauort und handelte mit dem Obersteiger das Gedinge aus. |
Ortsbrust | In einer aufzufahrenden Strecke die Gesteinsoberfläche am Streckenende, die zum Zweck des Vortriebs bearbeitet wird. |
P | |
Pickhammer | Abbauhammer |
| Pingen | (mhd. binge = Vertiefung, Graben); hier: a) allgemein: Vertiefung im Gelände, die entstanden, wenn ein im Untergrund befindlicher oberflächennaher Grubenbau einstürzte; (b) im Erzbergbau des "Alten Mannes": trichter-, oder schüsselförmige Vertiefungen, von Tagebauen oder kleinen Schächten (Schachtpinge) des mittelalterlichen Bergbaus. |
| Polnischer Türstock | |
Q | |
| Querschlag | Verbindungsstrecke zwischen 2 Bergwerksabschnitten, ein Ausrichtungsbau zur Erschließung einer Lagerstätte. |
R | |
Rammeln | Es hat gerammelt, sagten unsere Erzgräber, wenn untertage Erzwagen aus den Gleisen gesprungen waren und sich verkeilt hatten. |
| Aus einem ausgebeuteten Grubenbau das eingebaute Material z.B. Holz, Schienen, Stempel, Rohre, Kabel, Lutten (Rohre zur Bewetterung) zur Weiterverwendung zurückholen. Der ausgeraubte Grubenbau wird dann abgeworfen (stillgelegt). | |
| Rösche | untertägiger Graben zur Abführung von Grubenwasser |
S | |
Schacht | Lotrechter (senkrechter) oder tonnlägiger (schräger) Grubenbau, mit dem eine Lagerstätte von der Erdoberfläche aus erschlossen wird. |
| Schachtanlage Leonie | Auch das letzte noch fördernde Eisenerzbergwerk der Bundesrepublik, die der Maxhütte gehörende Grube Leonie, war in Auerbach beheimatet. |
| Schicht | Die Arbeitszeit eines Bergmanns, normalerweise in festgelegten Zeiträumen aufgeteilt. |
Dieser Schaustollen hat zwar nichts mit dem eigentlichen Bergbau zu tun, sondern wurde von Bergleuten als Luftschutzstollen angelegt. Sie erhalten aber hier ein Gefühl vermittelt wie es in den Strecken der hiesigen Gruben ausgesehen haben mag. Einiges Gezähe, das ist das Werkzeug der Bergleute, vermittelt Ihnen einige Eindrücke des Berufes des Bergmanns. | |
| Schießhauer | Ein "Schießhauer" im Bergbau ist eine historische Berufsbezeichnung für einen Bergarbeiter, der für das Sprengen von Gestein in Bergwerken verantwortlich war. |
Schlacke | bei der Verbrennung von Steinkohle, Koks und dem Schmelzen von Eisenerz in kleineren oder größeren Stücken zurückbleibende harte, poröse Masse; Verbrennungsrückstand |
ehemalige Reststoffdeponie der Maxhütte auf dem fast alle Abfälle der Maxhütte abgelagert wurden. Sanierung durch den Freistaat Bayern | |
| Schlagwetter | 5-14 % Grubengas(Methan) enthaltende explosive Luft, welche durch Zündquelle zur Explosion gebracht werden kann |
| Schlägel | kurzstieliger Hammer/Fäustel |
Schlägel und Eisen | |
Schlepper | Fördermann, war für das Schleppen der Hunte eingesetzt |
Schlössl | ehem. Werkskasino Maxhütte, wurde 1785 bis 1788 als Lustschloss der Pfalzgräfin Franziska Dorothea, die von 1768 bis 1794 im Sulzbacher Schloss wohnte, gebaut. |
Schlotte | Mit Wasser oder Sediment gefüllter Hohlraum im Gestein (des Karstes). Im Sulzbacher/Auerbacher Bergbau oft die Ursache für heftige Schwimmsand- und Wassereinbrüche. Wird eine Schlotte durch den Bergbau unten angeschnitten,kann der viele Tausend cbm umfassendde Inhalt in das Grubengebäude laufen. |
| Schuh | Längenmaß 17.Jahrhdt. etwa 0,3 m |
| Schürfen | nutzbare Mineralien auf ihrer natürlichen Lagerstätte aufsuchen |
Schwarten | Sägeraue Bretter mit Rindenteilen; wurden unter Tage zum Auskleiden, und Verschalen verwendet, so weit sie keiner Druckbelastung ausgesetzt waren. |
Schwimmsand | Was für den Kohlebergbau die Schlagwetter waren, war für den Erzbergbau der Wasser bzw. Schwimmsandeinbruch. Allerdings ist die Wirkung von Schlagwettern ungleich folgenschwerer. Im normalen Tiefbau (Kanalbau) heißt es Schwemmsand; im Bergbau sagte man Schwimmsand. Schwimmsand ist nicht nur Wasser mit Sand, es können auch Erz, Lehm und Reste vom alten Mann eingelagert sein. Die Steiger und erfahrene Bergleute konnten in der Regel abschätzen, wo es besonders gefährlich war, aber sicher war man nirgends. Bei großen Schwimmsandeinbrüchen drangen Wasser, Schlamm oder Sand sehr schnell in die Strecke vor – und wenn der Zufluss nicht gestoppt werden konnte, so lange - bis diese voll gelaufen war (d.h., das Wasser lief ab, die Feststoffe blieben liegen und füllten den Grubenausbau.) Es war wohl das folgenschwerste Unglück. 1939 an Fronleichnam gab es einen großen Wassereinbruch auf der Grube Fromm, bei dem die ganze Grube absoff und zur Allerweltskirchweih (dritter Sonntag im Oktober) brach dann unterhalb des früheren Feuerwehrhauses in Großenfalz eine Pinge ein, die über viele Jahre sichtbar blieb. |
| Seige | Graben zur Abführung von Grubenwässern |
eine auf hölzernen oder eisenen Böcken verlegte Seilbahn die das Erz von den Gruben bis zu den Hochöfen der Maxhütte brachte | |
| Sicherheitspfeiler | Die bekanntesten Sicherheitspfeiler sind die Schachtsicherheitspfeiler. Um vor den Abbaueinwirkungen zu schützen, wird ein Bereich zum Sicherheitspfeiler erklärt. In der Regel ist dieser kreisrund. Der Radius kann mehrere hundert Meter betragen und richtet sich nach dem vorhandenen Untergrund. Vgl.: https://de.wikipedia.org/wiki/Sicherheitspfeiler |
| Sohle | untere Begrenzungsfläche einer Strecke |
Spreißl | abgespaltenes Stück Holz; entstanden u.a. wenn der Gebirgsdruck den Holzausbau in der Grube zerdrückte. |
| Spurnagel | an früheren Förderwagen mittig angebrachte Zapfen zur Führung der Räder auf der Lauffläche |
12.05.1965 Annaschacht nimmt Förderung auf. 31.07.1974 Annaschacht stillgelegt | |
Aufsichtspersonen, ein Art Meister unter den Bergleuten | |
| Steigerlied | Das Steigerlied (auch Steigermarsch oder Glück auf, der Steiger kommt) ist ein deutsches Bergmanns- und Volkslied |
Stempel | stehende Holzteile zur Aussteifung des Grubenbaus, aus Rundhölzern. |
Stollen | Eingang eines Bergwerkes, der im hügeligen Gelände waagerecht oder geneigt ins Erdinnere führt. |
| Stoß | seitliche Begrenzung eines Grubenraums |
| Strecke | ein horizontal oder nur mit geringer Neigung aufgefahrener Grubenhohlraum, der zum Abbau oder zur Verbindung verschiedener Bergwerksbereiche dient, aber nicht an die Tagesoberfläche führt. Die wichtigste ist die Hauptförderstrecke. |
| Streckenvortrieb | Der Prozess des Grabens und Erweiterns von Stollen oder Tunneln, um die Erschließung neuer Abbaugebiete zu ermöglichen. |
| Sumpf | angelegte Vertiefung zur Ansammlung von Wasser (Pumpensumpf) |
T | |
| Tagesbruch | an der Erdoberfläche sichtbarer Einsturz eines Grubenbaus |
| taubes Gestein | Gestein ohne nutzbare Mineralien |
Teufe | Aus der Sprache des Mittelalters übernommener Begriff für Tiefe. |
| Trum, Trumm | Teil des Erzganges |
Türstock | Der Grubenausbau gehört zu den wichtigsten Sicherheitsvorkehrungen im Bergbau. Beim „Deutschen Türstock“, wie er im Sulzbach-Rosenberger Bergbau angewendet wurde, werden die Kappen mit den Stempeln verblattet. Dabei wird unterschieden, ob Firstendruck (von oben) oder Seitendruck vorherrscht. |
U | |
| Übertage | auf der Erdoberfläche |
| Untertage | unter der Erdoberfläche |
| unverritzt | vom Bergbau unberührt |
| Uraltungen | Uraltungen waren Abbauorte im Bereich von Eichelberg bis zur Grube Fromm, in früheren Jahrhunderten. Diese alten Abbauorte gingen maximal bis in eine Tiefe von ca. 90 m und rissen fast ausschließlich das obere Lager des Erzkörpers an. Sie lagen alle im guten Erz und wurden so weit in die Tiefe getrieben, als es noch möglich war, das anfallende Wasser zu heben. Der Ausbau der Strecken war sehr stark, d. h., die Hölzer standen dicht nebeneinander und waren entsprechend dick. Dies war dem Umstand geschuldet, dass der Abbau bzw. der Vortrieb aufgrund der Handarbeit sehr langsam vor sich ging. Deshalb mussten auch die Strecken entsprechend lange stehen bleiben. Die „ Alten“ hatten erhebliche Erzreste (hartes Erz) zurückgelassen, weil der Abbau mit Eisen und Schlägen zu schwierig war. |
V | |
| Verbrechen | zu Bruch gehen von Grubenbauen |
| Verhüttung | Der Prozess, bei dem Erz in einem Hochofen geschmolzen wird, um Metalle zu gewinnen. |
| verlorener Ausbau | vorläufiger Ausbau |
| Versatz | taubes Gestein zum Verfüllen von Hohlräumen |
Villa Max | Auch als Flick-Villa bezeichnet. Diente während des 2. Weltkriegs als Wohnsitz für die Ehefrau des Eigentümers der Maxhütte, dem Großindustriellen Friedrich Flick. |
| Vor Ort | untertägige Arbeitsstelle |
| Vortrieb | Auffahrung einer Strecke |
W | |
Wetter | bergmännische Bezeichnung für die ein- und ausstreichende Luft in einem Bergwerk. |
| Wetterführung | Maßnahme, um Grubenbauen frische Luft zuzuführen |
Wetterschacht | Wetter nennt der Bergmann die Luftmengen, die für eine Belüftung der untertägigen Grubenräume sorgen |
| Wettertüre | Absperrung im Grubengebäude zur Regulierung der Wetterführung |
Z | |
| Zeche | Bergwerk, Grube |
| Zechenhaus | Huthaus, Gebäude am Schacht- oder Stollenmundloch |
| Zimmerung | Grubenausbau aus Holz |
| Zoll | altes Längenmaß( 1 Zoll =1/12 Fuß=1/80 Lachter=0,02615 m) |
Straßennamen die mit dem Bergbau zu tun haben
Am Annaschacht
An der Maxhütte
Bergknappenstraße
Erzhausstraße
Glückaufstraße
Grubenweg
Karolinenstraße
Klenzestraße
Markscheiderstraße
Schachtstraße
Schlepperweg
Seilbahnweg
Steigerstraße
Stollengasse: ist die einzige Straßenbezeichnung, die einen reellen Bezug zum früheren Bergbau hat. Es gibt die begründete Annahme, dass in der Stollengasse einer oder mehrere Stollen mündeten, mit denen die Erzkörper in Richtung Galgenberg entwässert wurden.
Seilbahnweg: ebenfalls eine Bezeichnung mit lokalem Bezug. Über den Seilbahnweg verlief früher die Seilbahn von den Bergwerken in die Maxhütte.
Spitznamen der Bergleute
Weiherblasch, Korkenzaicher, Schurz, Kuller, Friedhofsbomber, Schokalad, Bodawaschl, Pfeiferlsteiger,